Gendermedizin – das Geschlecht macht den Unterschied
Die geschlechterspezifische Medizin stützt die individuelle Versorgung von Patientinnen und Patienten, indem sie die Unterschiede zwischen Mann und Frau berücksichtigt. Diana Mattiello und Rubén Fuentes erklären, wie sie die Gendermedizin am Spital Limmattal in die Praxis umsetzen.

Text und Bilder: Flavian Cajacob
Beim Thema «Gender» gehen die Wogen hoch. Während die einen darin ihre Identität manifestiert sehen, winken andere bereits ab, wenn sie irgendwo einem * (Sternchen) begegnen. Dabei bedeutet das englische Wort «Gender» eigentlich nichts anderes als «Geschlecht». Gemeint ist damit allerdings nicht das biologische, also angeborene Geschlecht, sondern das soziale, gefühlte, letztlich eben gelebte.
Sex & Gender
Im Unterschied zur deutschen Sprache macht die englische einen Unterschied zwischen dem biologischen Geschlecht («sex») und dem sozialen Geschlecht («gender»), also der Geschlechterrolle, die gesellschaftlich geprägt und individuell angeeignet worden ist. Die geschlechterspezifische Medizin ihrerseits beschreibt eine interdisziplinäre Betrachtungsweise der Humanmedizin, die den Einfluss des biologischen und psychosozialen/soziokulturellen Geschlechts auf Gesundheit und Krankheit berücksichtigt.
Rollen und Normen prägen mit
Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau. Viele davon sind offensichtlich. Gerade in der Medizin indes gibt es auch solche, die sich nicht rein biologisch, etwa mit dem Körperbau oder den Hormonen erklären lassen. Verschiedene Studien würden denn auch aufzeigen, dass Gesundheit und Gesundheitsverhalten stark durch anerzogene, erlernte oder aufgezwungene Geschlechterrollen geprägt und beeinflusst würden, sagt Diana Mattiello. «Also dadurch, wie jemand mit den gesellschaftlichen Normen umgeht, respektive, wie jemand diesen unterworfen ist.»
Diana Mattiello ist Leitende Ärztin für Allgemein-, Gefäss- und Viszeralchirurgie im Spital Limmattal. Ihr Spezialgebiet: Bariatrie – die Behandlung von stark übergewichtigen Menschen. Gerade bei Adipositas zeigt sich auf beispielhafte Art und Weise, wie männliche und weibliche Wahrnehmung und Verhaltensweisen sich unterscheiden. «Der Anteil Übergewichtiger in der Bevölkerung ist bei den Männern höher als bei den Frauen», führt Mattiello aus. In ihre medizinische Obhut begeben sich jedoch weit mehr Frauen als Männer. Dies entweder aus gesundheitlichen Gründen, auf ärztliches Anraten hin oder auf Druck von aussen. «Das Bewusstsein für die Krankheit ist bei den Männern auch heute noch viel weniger ausgeprägt als bei den Frauen», erklärt die Spezialistin und kommt auf einen klassischen Stereotyp zu sprechen: «Anders als eine beleibte Frau ist ein Mann mit einem Bauch gesellschaftlich akzeptierter. In den Augen der Öffentlichkeit gehört sich das ab einem gewissen Alter sogar schon fast ein bisschen.»
Dass diese in weiten Kreisen vorherrschende Grundeinstellung dazu führt, dass der eine oder andere den richtigen Zeitpunkt verpasst, sich einer Behandlung zu unterziehen, und damit gesundheitliche Schäden in Kauf nimmt, ist mehr als nachvollziehbar. «Gendermedizin berücksichtigt genau solche Umstände, die bei den Geschlechtern für Verhaltensunterschiede sorgen», sagt Diana Mattiello. Was nicht allein Einfluss hat auf die konkrete Behandlung, sondern insbesondere ebenso auf die Prävention. Mit einem Fragebogen geht die bariatrische Chirurgin auf die Beweggründe ihrer Patientinnen und Patienten ein, weshalb diese sich einer Operation unterziehen. «Die Antworten ermöglichen es mir, Betroffene inskünftig noch viel gezielter für die Thematik Übergewicht zu sensibilisieren. Vor allem die Männer.»
Der vermeintliche Durchschnittsmensch: jung, weiss, männlich
Ihre Anfänge hat die Gendermedizin in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren. Über die Jahrhunderte hinweg war das allgemeine Weltbild männlich dominiert. Kein Wunder also, diente auch in der Medizin lange Zeit der Mann als Prototyp für den Menschen, an dem sich das Wissen rund um Krankheitsbilder, Diagnose und Therapie orientierte. Anatomie, Physiologie und Krankheitsmuster wurden konsequent über einen Kamm geschert. Und der damit sorgfältig gekämmte Einheitsmensch war jung, weiss und männlich.
Mit dem Aufbranden der dritten Welle der Frauenbewegung rückte dann vor gut dreissig Jahren das Thema Frauengesundheit vermehrt in den Fokus von Wissenschaft und Forschung. Und damit die Erkenntnis, dass es mit Blick auf die Gesundheit sehr wohl eine Rolle spielt, ob man/frau Mann oder Frau ist. Ein weiterer Schritt in Richtung personalisierte Medizin war damit getan. Die damalige Nähe zur Frauenbewegung führte hingegen dazu, dass die medizinische Disziplin vielerorts mit feministischen Grundsätzen gleichgesetzt wurde, obwohl vom geschlechterspezifischen und personalisierten Ansatz sowohl Frauen wie Männer gleichermassen profitieren. Selbst heute widmen sich weit mehr weibliche als männliche Fachpersonen der Materie. So ist Rubén Fuentes momentan der einzig männliche Teilnehmer am «CAS in Sex- and Gender-Specific Medicine» der Universitäten Zürich und Bern.
2001 schliesslich gab die Weltgesundheitsorganisation WHO die Empfehlung für die Entwicklung einer geschlechterspezifischen Gesundheitsversorgung heraus. «Diese gründet in der Tatsache, dass neben Genen und Hormonen auch Geschlechterrollen und deren Auslegung einen grundlegenden Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit haben», bemerkt dazu Rubén Fuentes.
Aufklärungsarbeit erforderlich
Rubén Fuentes ist Assistenzarzt Innere Medizin am Spital Limmattal und forscht darüber hinaus zu Geschlechterunterschieden in der Kardiologie. Er moniert, dass die Gendermedizin häufig falsch verstanden werde. «Ich persönlich spreche deshalb lieber von ‘geschlechterspezifischer Medizin’, aus dem einfachen Grund, weil das Wort ‘Gender’ seit ein paar Jahren politisch aufgeladen ist und bei vielen Menschen eine ablehnende Haltung hervorruft.»
Das sei nicht nur schade, sondern könne mitunter beinahe fahrlässig sein. Gerade im medizinischen Bereich, sagt Fuentes. «Druck im Brustkorb, Ziehen im linken Arm, das sind die bekannten Symptome für einen Herzinfarkt – Symptome, wie sie häufig bei Männern auftreten.» Bei Frauen manifestiere sich ein Herzinfarkt hingegen häufig ganz anders, beispielsweise in Form allgemeiner Schwäche oder Magenschmerzen. Zwei Geschlechter, zwei komplett unterschiedliche Anzeichen für ein- und denselben Ernstfall also.
Aber auch mit Blick auf die weit verbreiteten Herzrhythmusstörungen, auf die sich der Mediziner längerfristig zu spezialisieren gedenkt, gibt es merkliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. «Sowohl was den direkten Einfluss der weiblichen und männlichen Hormone auf Ursache, Schutz vor und Verlauf der Arrhythmie anbelangt als auch in Bezug auf die Wirksamkeit von Medikamenten und Interventionen.» In seiner Doktorarbeit ging Fuentes darüber hinaus auf den Effekt der Kardiorehabilitation bei Herzkranken auf die Verbesserung der körperlichen Fitness ein. In der Praxis werden demnach weit weniger Frauen einer Herzrehabilitation zugewiesen als Männer, obwohl die weiblichen Probandinnen grössere Fortschritte der Leistungsfähigkeit zeigten als die männlichen.
Zwei Geschlechter, zwei komplett unterschiedliche Anzeichen für ein- und denselben Ernstfall also.
«Die von der geschlechterspezifischen Medizin gestützte Herangehensweise orientiert sich genau an solchen Diskrepanzen und will das Bewusstsein für unterschiedliche Symptome bei gleichem Krankheitsbild fördern, in der Bevölkerung genauso wie beim Fachpersonal», betont Rubén Fuentes. Letztlich verbessere die in die herkömmliche Gesundheitsversorgung integrierte Gendermedizin die Qualität der gesamten wie auch und insbesondere der individuellen, personalisierten Patientenversorgung.
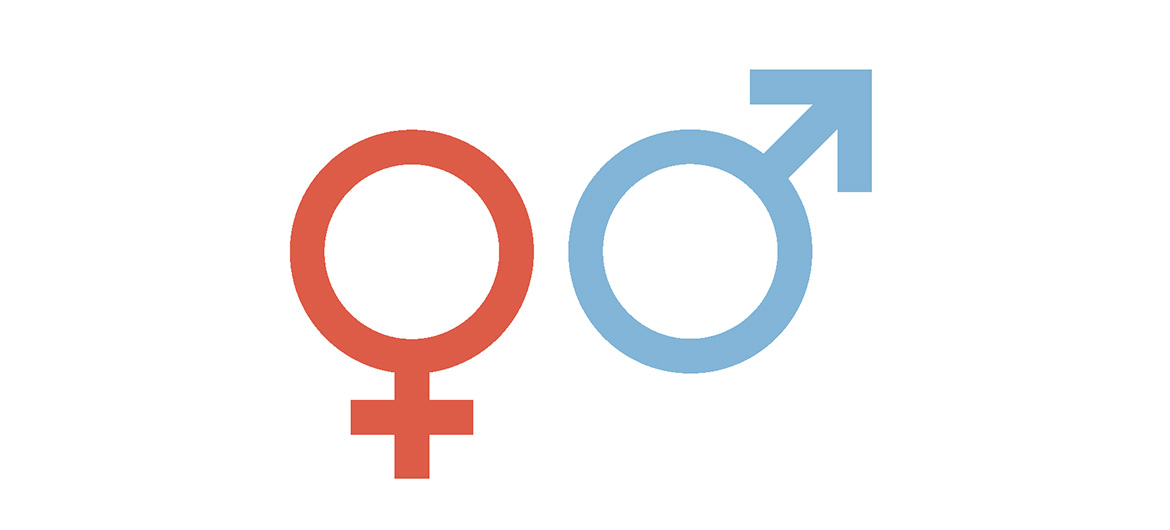
Vom Herzen bis zur Psyche
Die Gender- oder geschlechterspezifische Medizin richtet sich auf die drei Kernbereiche Wissenschaft und klinische Medizin, die Lehre sowie die Praxis aus, also auf die Verankerung in der Behandlung. Sie entwickelt sich ständig weiter und stützt sich auf verschiedene Aspekte, so etwa den biologischen Unterschied, Krankheitsmuster oder Medikamentenreaktionen.
Wenngleich Forschung und Lehre die Diversität der Geschlechter inzwischen in ihre Arbeit einfliessen lassen: in der Praxis sei es noch ein weiter Weg zur lückenlosen Umsetzung der gendermedizinischen Ziele, sind sich Diana Mattiello und Rubén Fuentes einig. «Das meiste spielt sich in diesem Zusammenhang nach wie vor in den Köpfen ab», sagt die Leitende Ärztin. Rubén Fuentes unterstreicht diese Tatsache mit einer noch nicht allzu weit zurückliegenden Anekdote: «Da fragte mich doch tatsächlich eine medizinisch versierte Person, weshalb sich meine Kollegin Dr. Mattiello plötzlich auf Geschlechtsumwandlungen spezialisieren würde. » Leichte Konsternation mischt sich ins gemeinsame Amüsement. «Sie sehen, es herrscht noch einiges an Nachholbedarf», bemerkt Diana Mattiello.
Frauen leben länger – aber…
Frauen (85.4) und Männer (81.6) haben eine unterschiedlich hohe Lebenserwartung bei Geburt. Frauen in der Schweiz leben im Durchschnitt vier Jahre länger. Dabei gelten zwei Einschränkungen: Frauen leben zwar länger als Männer, jedoch bei einer allgemein weniger guten Gesundheit – und der Unterschied der Lebenserwartung bei Geburt verringert sich im Laufe der Jahre. In der Tat hat sich seit den 1990er-Jahren die Lebensweise der Frauen jener der Männer angenähert, im Erwerbsbereich (Erwerbsquote, Beschäftigungsspektrum) wie auch in Bezug auf das Rauchen und den Alkoholkonsum. Erklärend kommen auch die rascheren Fortschritte bei Krankheiten, die früher vor allem Männer betrafen, dazu (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen).
Der klare Vorteil der Frauen bezüglich der Lebenserwartung bei Geburt wird abgeschwächt, wenn nach der Lebensqualität, insbesondere nach den allgemeinen gesundheitlichen Beschwerden und den funktionellen Einschränkungen gefragt wird. Diese treten bei Frauen im Allgemeinen häufiger auf und können die persönliche Autonomie einschränken. So wird die höhere Lebenserwartung bei Geburt für Frauen durch die Lebenserwartung bei guter Gesundheit relativiert. Diese beträgt bei den Frauen 71,7 Jahre und bei den Männern 70,7 Jahre. Diese geringere Differenz zwischen den Geschlechtern zeigt, dass die Frauen die zusätzlichen Lebensjahre zu einem grossen Teil mit gesundheitlichen Beschwerden verbringen.
(Quelle: Bundesamt für Statistik BFS)
Der Weg in die Zukunft
Im internationalen Vergleich nimmt die Schweiz in Sachen Gendermedizin aktuell einen Platz im Mittelfeld ein. Höchstens.
Führend sind Kanada und die USA. Dennoch: Es tut sich etwas! So wird die Universität Zürich im nächsten Frühling einen Lehrstuhl in geschlechterpezifischer Medizin besetzen. Gemeinsam mit der Universität Bern führt sie zudem bereits einen CAS-Studiengang mit Gendermedizin durch. Sowohl Diana Mattiello als auch Rubén Fuentes und zwei ihrer Kolleginnen am Spital Limmattal haben diesen bisher absolviert oder absolvieren ihn aktuell – und fühlen sich vom vermittelten Inhalt in ihrem alltäglichen Tun gestützt. «Mann und Frau, binär und nonbinär – auch in der Medizin ist nicht alles schwarzweiss», sagt Diana Mattiello.
Für sie und ihren Kollegen gehört die junge Disziplin der Gendermedizin inskünftig fest verankert in den medizinischen Diskurs. Sie sehen es nebst ihren medizinischen Aufgaben als Ziel, die Sensibilität im Spital Limmattal entsprechend weiter zu fördern, etwa im Rahmen von Informationsveranstaltungen oder der internen Schulung. «Es ist sicherlich ein langer Weg, bis all die damit verknüpften Überlegungen und Verhaltensweisen auch bei uns alltäglich sein werden», bemerkt Rubén Fuentes, der sich eine Entpolitisierung des Begriffs «Gender» und einen sachlicheren Umgang mit der Thematik wünscht. Letztlich sei klar: «Der geschlechterspezifischen Medizin gehört die Zukunft.» Diana Mattiello schmunzelt und verweist auf das Motto des Spitals Limmattal: «Top Medizin. Persönlich. Individuell.» Gendermedizin sei in ihrer Art nichts anderes als ein Teil der persönlichen und individuellen Medizin, wie sie vom «Limmi» propagiert und umgesetzt werde. «An uns ist es jetzt, mit Vorurteilen und Fehlannahmen aufzuräumen und das Bewusstsein zu schärfen. Wenn in Diagnostik und Behandlung die Unterschiede zwischen den Geschlechtern automatisch berücksichtigt werden, haben wir in meinen Augen schon sehr viel erreicht.»
Zu den Bereichen, in denen die Gendermedizin ansetzt, gehören beispielsweise:
Kardiologie
Frauen und Männer können unterschiedliche Symptome von Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufweisen. Frauen neigen dazu, atypische Symptome zu haben, was zu Fehl oder verzögerten Diagnosen führen kann.
Psychiatrie
Geschlechterspezifische Unterschiede im Ausdruck und in der Behandlung von psychischen Erkrankungen werden in der Gendermedizin berücksichtigt. So weisen Frauen hinsichtlich einer möglichen Depression ein weit ausgeprägteres Sensorium auf als Männer – bei letzteren besteht dahingehend eine grosse Dunkelziffer. Und da sich Frauen eher an einer Studie zum Thema Depression beteiligen als Männer, wird die Behandlung mehrheitlich auf weibliche Aspekte abgestützt.
Endokrinologie/Metabolismus
Metabolische Erkrankungen beeinflussen das Leben von Männern und Frauen in den verschiedenen Lebensabschnitten in unterschiedlicher und vielfältiger Weise. Beispielsweise weisen Männer im jüngeren Alter und bei niedrigerem BMI ein höheres Risiko für Typ-2-Diabetes auf als Frauen, die wiederum von einem starken Anstieg des Risikos für Diabetes-assoziierte kardiovaskuläre Erkrankungen nach der Menopause betroffen sind.
Onkologie
Einige Krebsarten zeigen geschlechterspezifische Unterschiede in der Häufigkeit und im Verlauf. Die Art der Hormone und deren unterschiedliche Konzentration können sich je nach Geschlecht schützend bezüglich Tumoren oder als Risikofaktor erweisen. Darüber hinaus können die Wirksamkeit von Krebstherapien und die Nebenwirkungen bei Frauen und Männern variieren.
Pharmakologie
Die Gendermedizin berücksichtigt, wie Medikamente von Frauen und Männern abgebaut werden und wie sie auf sie wirken. Dies ist wichtig für die Dosierung und die Vermeidung von unerwünschten Nebenwirkungen.
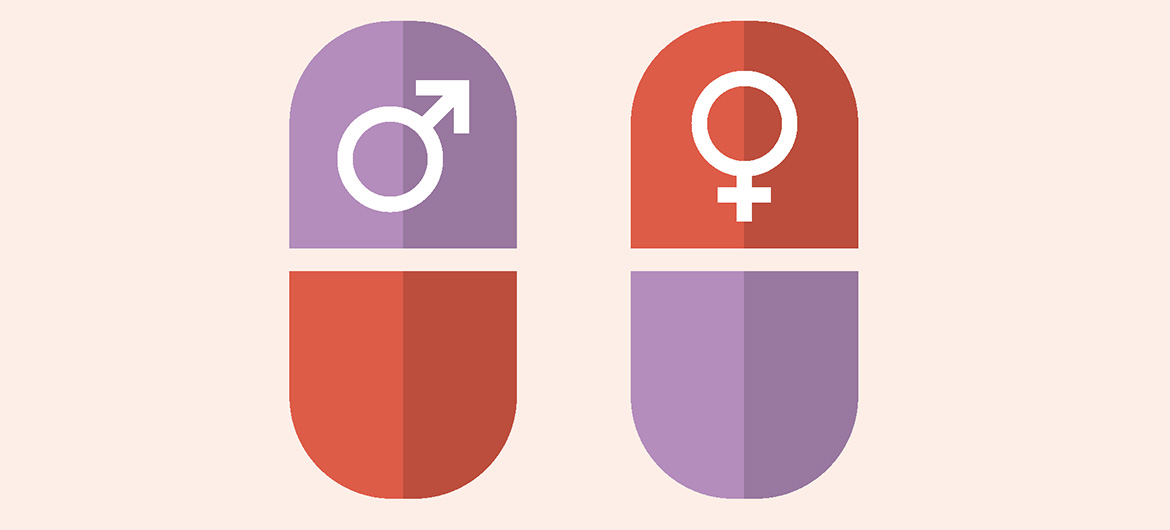
11 Millionen Franken für die Forschung
Nicht nur die Medizin selbst, sondern auch die Politik misst der Gendermedizin grosse Bedeutung bei. Diesen Sommer hat der Bundesrat den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) beauftragt, ein Nationales Forschungsprogramm «Gendermedizin und Gesundheit» (NFP 83) durchzuführen. Dieses soll Ende Jahr ausgeschrieben werden. Das NFP ist mit 11 Millionen Franken dotiert. Es will zu einem «Kulturwandel beitragen und Standards erarbeiten». Zudem soll es Ausgangspunkt sein für eine langfristig ausgerichtete Forschung in der Gendermedizin.
Das NFP untersucht unter geschlechter- und genderspezifischer Perspektive vier Schwerpunkte:
Gesundheitsversorgung und Prävention
Medizinische Behandlungen und Therapien
Wirkmechanismen in der Medizin und der öffentlichen Gesundheit
Soziale und gesellschaftliche Auswirkungen
Die Forschung in diesem NFP verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, bei dem Forschende aus unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammenarbeiten. Themenübergreifende Kooperationen mit der Praxis sind nach Ansicht des Bundesrats für den Erfolg des Programms von entscheidender Bedeutung.
Im Blickpunkt: "Gendermedizin - das Geschlecht macht den Unterschied"






